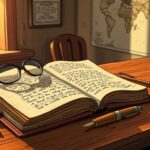Wer hätte gedacht, dass eine Chefredakteurin irgendwann Bomben statt Kolumnen liefert? So absurd klingt die Geschichte einer Frau, die vom Schreibzeug zur Waffe griff.
Aus der bürgerlichen Journalistin wurde die meistgesuchte Terroristin der Roten Armee Fraktion. Stefan Aust spöttelte später über ihre «Vorliebe für Parkplatzsuche während Banküberfälle» – weil selbst Revolutionäre nicht ohne Parkticket auskommen.
Heute gibt’s TikTok-Aktivismus statt RAF-Kult. Aber damals? Da plante man Revolutionen zwischen zwei Deadlines. Stressig war anders.
Kindheit und frühe Jahre von Ulrike Meinhof
Von Puppen zu politischen Pamphleten – eine ungewöhnliche Jugend. Stell dir vor, du verlierst beide Eltern, bevor du 15 bist. Kein Wunder, dass sie später Rebellen-Lektüre statt Poesiealben bevorzugte.
Die prägenden Verluste in ihrer Jugend
Geboren am 7. Oktober 1934 in Oldenburg, erlebte sie früh Tragödien. Ihr Vater starb 1939, die Mutter folgte 1948. Plötzlich Waisenkind – aber nicht allein. Renate Riemeck, Historikerin und Pazifistin, wurde ihre Mentorin.
Einfluss von Renate Riemeck und politische Sozialisation
Riemeck war mehr als eine Ersatzmutter. Sie brachte ihr bei, dass Frieden nicht nur Abwesenheit von Krieg bedeutet. Kein Wunder, dass sie später in Schülerzeitungen über Gerechtigkeit schrieb – ihr erstes Spektrum.
| Schule | Einfluss | Jahr |
|---|---|---|
| Liebfrauenschule | Katholische Prägung | 1940er |
| Rudolf-Steiner-Schule | Alternative Pädagogik | 1950er |
| Heim bei Riemeck | Pazifismus & Sozialismus | ab 1948 |
Während andere Teenager über Mode schwärmten, diskutierte sie Theologie. Karl Barth statt Bravo – nicht gerade Standard für die 1950er Jahre.
Studienzeit und erste politische Aktivitäten
Marburg 1955: Wo andere Bücher wälzten, entdeckte sie die Macht der Worte – und der Straße. Stell dir vor, du studierst Philosophie und landest zwischen Flugblättern und Demo-Mikrofonen. So begann eine Karriere, die kein Berufsberater vorhersah.
Engagement im SDS und Anti-Atomtod-Bewegung
1958 trat sie dem SDS bei – dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Hier ging’s nicht nur um Marx-Zitate, sondern auch um schlechten Wein und gute Pläne. Bei einer Demo entdeckte sie das Mikrofon – und wie sich mit Worten Kampf führen lässt.
Ihr Thema: Atomwaffen. 1959 organisierte sie den Studentenkongress gegen Atomrüstung. Kein TikTok-Protest, sondern harte Arbeit. Flugblätter statt Hashtags – damals hatte Aktivismus noch Fingerabdrücke.
Die Rolle der Zeitschrift «konkret» in ihrer Entwicklung
1959 erschien ihr erster Artikel in der Zeitschrift «konkret»: «Der Friede macht Geschichte». Kein Kaffeeklatsch, sondern Kaffeekränzchen mit Revolutionsplanung. Die Redaktion wurde ihr zweites Zuhause – und ihre Waffe die Schreibmaschine.
In den späten 1950er Jahren mischte sie so die Medienlandschaft auf. Heute liken wir Posts – damals schrieb man noch Artikel, die etwas bewirkten. Wie ein kritischer Blick zeigt, war das der Startpunkt einer radikalen Wandlung.
Ulrike Meinhof als Journalistin und Chefredakteurin
Als Journalistin bei «konkret» traf sie Nerven. Ihre Artikel waren wie Pfeile – manche trafen ins Schwarze, andere in den Fettnapf. Stell dir vor, du schreibst so scharf, dass selbst Politiker zittern.
Worte als Waffen: Ihre prägenden Kolumnen
1965 nannte sie Franz Josef Strauß den «infamsten Politiker«. Preis: 600 DM Strafe. Ironie des Schicksals: Die Klage machte den Artikel berühmter als jede Anzeige.
Ihre Texte waren Sprengstoff in Druckform. Kein Wunder, dass die Redaktion bald ihr zweites Zuhause wurde – und die Schreibmaschine ihre treueste Waffe.
Liebe und Linientreue: Die Ehekrise
1961 heiratete sie Klaus Rainer Röhl, den Herausgeber von «konkret». Power-Couple? Eher Pulverfass! Er wollte Anzeigen, sie Revolution. «Unsere Ehe scheiterte an Mao und Männern», spottete Röhl später.
1962 kamen Zwillinge – doch Kinder, Karriere und Komplotte passten schlecht zusammen. Während sie Flugblätter entwarf, wollte er die Auflage steigern. Stressig war anders.
1968 war Schluss. Der Bruch mit Klaus Rainer Röhl markierte eine Wende. Aus der Chefredakteurin wurde eine Frau auf der Suche nach radikalen Antworten.
«Sie diskutierte Revolution beim Abendbrot – ich wollte einfach nur essen.»
Diese Zeit zeigt: Manchmal ist die Feder mächtiger als das Schwert. Aber wer zu scharf schreibt, darf sich über Papierschnitte nicht wundern.
Die Radikalisierung in den 1960er Jahren
1967: Blumen im Haar, Steine in der Hand – die 60er kippen ins Radikale. Aus Friedensliedern wurden Brandsätze, aus Diskussionen Straßenschlachten. Plötzlich war die Frage nicht mehr «Wie ändern wir die Welt?», sondern «Mit oder ohne Gewalt?»
Einfluss der Studentenbewegung und APO
Stell dir vor, du trinkst Kaffee mit Kommilitonen – und planst nebenbei die Revolution. So lief’s beim SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund). Die APO (Außerparlamentarische Opposition) war ihr Spielplatz, Benno Ohnesorgs Tod 1967 der Wendepunkt.
Aus «Make Love, Not War» wurde «Molotow statt Marsch». Die Jahre 1967/68 zeigten: Wer nicht gehört wird, greift zur Flasche – mit Benzin gefüllt.
Die Begegnung mit Andreas Baader und Gudrun Ensslin
1968: In einem Frankfurter Café traf sie das «Bad-Boy-/Girl-Duo» der Politik: Andreas Baader, der Rebell ohne Plan, und Gudrun Ensslin, die Intellektuelle mit Zündstoff. Ihr erstes Date? Ein Gerichtstermin – wegen Kaufhausbrandstiftung.
Aus dem Trio wurde ein gefährliches Spiel: «Terroristen-Tinder» – man swipte nicht nach rechts, sondern nach radikal. Die Warenhausbrandstiftung 1968 war ihr gemeinsames «Projekt». Gewalt als Mittel? Für sie plötzlich kein Tabu mehr.
«Wir diskutierten Revolution beim Espresso – sie bestellten ihn mit Napalm.»
Die Baader-Befreiung: Wendepunkt in Meinhofs Leben
14. Mai 1970: Ein Datum, das die Bundesrepublik in Atem hielt. Stell dir vor, du planst eine Büroklammer-Rettung – und landest in den Schlagzeilen. So absurd begann der Tag, der alles veränderte.
Planung und Durchführung der spektakulären Aktion
Die Befreiung von Andreas Baader war kein spontaner Streich. Aktenordner als Waffen, Fenster als Fluchtwege – ein Drehbuch, das Hollywood nicht besser hätte schreiben können. Die Gruppe nutzte ein Scheininterview, um ins Berliner Institut zu gelangen.
Dann ging alles schnell: Schüsse fielen, Georg Linke wurde schwer verletzt. Baader und sie sprangen durchs Fenster – «Prison Break» ohne Scofield, aber mit mehr Pressewirbel.
«Plötzlich flogen da Leute raus wie in einem Actionfilm – nur ohne Stuntdoubles.»
Folgen und Verletzungen bei der Befreiung
Die Polizei war baff: Wie konnte eine Journalistin zur Fluchthelferin werden? Linkes Verletzung löste Empörung aus – doch die RAF feierte die Aktion als Sieg. Die Medien titelten: «Von der Feder zur Pistole.»
| Betroffene | Rolle | Folgen |
|---|---|---|
| Georg Linke | Institutsmitarbeiter | Schwere Schussverletzung |
| Andreas Baader | Befreiter | Flucht, später Fahndungsaufruf |
| Presse | Berichterstattung | Medienhype um RAF |
Der 14. Mai 1970 war kein gewöhnlicher Tag. Er war der Moment, in dem Theorie zur Praxis wurde – und eine Gruppe zur Legende.
Die Gründung der Roten Armee Fraktion (RAF)

Die RAF entstand nicht im Hörsaal, sondern zwischen Wüstensand und Waffenlagern. Stell dir vor, du tauschst Seminararbeiten gegen Sprengstoffhandbücher – so begann Deutschlands berüchtigtste Terrorgruppe. 1970 war kein Jahr für halbe Sachen.
Ideologische Grundlagen und Ziele der Gruppe
Marxismus mit praktischem Nutzen: Die rote armee fraktion mixte Theorie und Gewalt. Ihr Rezept? Eine Prise Klassenkampf, zwei Löffel Anti-Imperialismus – und viel Wut.
Die Mitglieder waren bunt gemischt: Vom Anwalt bis zur Journalistin. Gemeinsam war ihnen der Glaube: Nur durch Aktion kommt die Revolution. «Stadtguerilla» nannten sie das – Stadtführer mit Kalaschnikow.
Die Ausbildung in Jordanien und Rückkehr nach Deutschland
Sommer 1970: Während andere am Baggersee lagen, übten deutsche Rebellen in Jordanien das Schießen. Die PLO lehrte sie, wie man Brücken sprengt – und Kaffee richtig zubereitet. Kultureller Austausch der besonderen Art.
Die Jahre danach zeigten: Sand in den Schuhen blieb, Ideale verflogen. Zurück in Deutschland ging’s nicht mehr um Diskussionen, sondern um Aktionen. Aus Studenten wurden Guerillas – mit deutschem Akzent.
«Wir kämpfen gegen das System – aber vergesst nicht die Mülltrennung!»
Die rote armee fraktion war kein gewöhnlicher Verein. Kein Mitgliedsausweis, dafür Haftbefehle. Ihr Erbe? Eine Mischung aus Faszination und Abscheu – wie ein schlechter Actionfilm mit tragischem Ende.
Die Mai-Offensive der RAF und ihre Folgen
Mai 1972: Während andere Blumen pflückten, zündete die rote armee fraktion Sprengsätze. Sechs Anschläge in zwei Wochen – Frühlingserwachen der Bomber. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und neben dir explodiert ein Polizeiauto. Stressig war anders.
Bombenanschläge und öffentliche Reaktionen
Die Ziele waren klar: US-Kasernen, Polizeistationen, der Springer-Verlag. Am 11. Mai traf es Frankfurt, am 24. Heidelberg. Ergebnis: 33 Tote, über 200 Verletzte. Plötzlich hatte jeder Angst vor Parkbänken – obwohl die RAF nie Zivilisten treffen wollte.
| Datum | Ort | Ziel |
|---|---|---|
| 11.05.1972 | Frankfurt | US-Offizierskasino |
| 24.05.1972 | Heidelberg | US-Hauptquartier |
| Mai 1972 | München | Landeskriminalamt |
Die Medien tobten: «Blume und Bombe» titelte der Spiegel. Selbst Oma Erna checkte nun Parkbänke – polizei hin oder her. Die RAF verlor Sympathien, gewann aber Schlagzeilen.
Festnahme und Inhaftierung
15. juni 1972: In Langenhagen ging die Party zu Ende. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die polizei nicht nur Waffen – sondern auch Kinderzeichnungen. Tipp für Revolutionäre: Beweismittel besser verstecken!
«Sie trank gerade Kaffee – wir Handschellen. Kein Actionfilm, nur traurige Realität.»
Die festnahme markierte das Ende ihrer Freiheit. 1974 gab’s 8 Jahre Haft für die Baader-Befreiung. Juni 1972 wurde zum Wendepunkt – aus der Guerilla wurde eine Gefangene.
Haftbedingungen und Hungerstreiks
Isolationshaft war kein Wellness-Urlaub – eher Beton-Ferien mit Handschellen-Service. Stell dir vor, du sitzt in einer Zelle von 3×3 Metern. Moderne Studentenbuden wirken dagegen wie Suiten.
Isolationshaft und psychische Belastung
1972 in Köln-Ossendorf: Kein Fenster, kein Kontakt, nur Betonwände. Die haftbedingungen waren so hart, dass selbst Gefängniswärter mit den Augen rollten. «Knast-Chic der 70er: Grau in Grau mit Sicherheits-Extras.»
Psychologen warnten früh – Isolation macht krank. Doch der Staat blieb stur. Revolutionäre im gefängnis? Da galt: Je härter, desto besser.
Proteste gegen die Haftbedingungen
1973 startete der erste hungerstreik. Keine Diät, sondern ein Hilfeschrei. «Abnehmen für die Revolution» – so bitter der Witz war, so ernst das Anliegen.
1974 eskalierte es: Holger Meins starb nach 58 Tagen ohne Essen. Die RAF nannte es Mord, der Staat «Selbstmord». Die zelle wurde zum Symbol – für Widerstand und Ohnmacht.
| Jahr | Aktion | Folge |
|---|---|---|
| 1972 | Isolationshaft | Psychische Zusammenbrüche |
| 1973 | 1. Hungerstreik | Keine Zugeständnisse |
| 1974 | 2. Hungerstreik | Tod von Holger Meins |
«Wir stopften ihnen Nahrung ein – aber keine Argumente.»
Der Stammheim-Prozess und die Anklage

Stammheim 1975: Wo sonst Anzüge glänzten, prallten nun Ideologien aufeinander. Stell dir vor, du sitzt im Prozess des Jahrhunderts – und die Anklageschrift ist dicker als das Telefonbuch. «Justiz-Soap deluxe: mit Tränen, Wut und Handschellen».
Vorwürfe und Verteidigungsstrategien
Die Anklage warf den RAF-Mitgliedern fünf Morde und 54 Mordversuche vor. Stefan Aust spottete später: «Das Tribunal, bei dem selbst die Anwälte schwitzen lernten.» Die Verteidigung argumentierte mit dem Vietnamkrieg – erfolglos.
Gudrun Ensslin gestand 1976. Ihr Text dazu? Knapp und klar: «Wir kämpften gegen ein mörderisches System.» Das Gericht sah das anders – für Richter waren es schlicht Verbrechen.
| Datum | Ereignis | Besonderheit |
|---|---|---|
| Mai 1975 | Prozessbeginn | 317 Verhandlungstage |
| 1976 | Ensslins Geständnis | Politische Rechtfertigung |
| Mai 1976 | Tod in der Zelle | Ungelöste Fragen |
Die Rolle im Prozess
Von schweigsam bis sarkastisch – ihre Auftritte waren unberechenbar. Stefan Aust notierte: «Mal eine Märtyrerin, mal eine müde Frau.» Die Medien liebten dieses Wechselspiel.
«Vor CNN gab’s nur Schreibmaschinen-Geklapper – aber der Skandal war perfekt.»
Der Prozess wurde zum Symbol. Für die einen das Ende des Terrors, für andere ein Justizdrama. Eins war klar: Nach Stammheim war nichts mehr wie vorher.
Der Tod von Ulrike Meinhof in Stammheim
9. Mai 1976: Ein Tag, der mehr Fragen hinterließ als Antworten. In ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim fand man sie erhängt – offiziell ein Tod durch eigene Hand. Doch viele Zweifel blieben.
Umstrittene Umstände
Stell dir vor, du bastelst einen Strick aus Handtüchern – Todes-DIY der traurigen Art. Die Schlinge war zu groß, die Obduktion zeigte Widersprüche. Stefan Aust schrieb später: «Ein Rätsel wie Ostereierfärben – jeder hat seine Theorie.»
Ihre Schwester Wienke war überzeugt: «Wenn ich im Gefängnis umkomme, dann ist es Mord.» Die RAF kolportierte sogar Vergewaltigungsvorwürfe. Doch Beweise? Fehlanzeige.
Echo eines Skandals
15. Mai 1976: Bei der Beerdigung kamen mehr Blumen als Bomben. Aus Terroristen wurden plötzlich Trauergäste. Mai 1976 zeigte: Der Tod macht trendy – aus Radikalen wurden Pop-Ikonen.
«Von Stasi bis CIA – wer war schuld? Die Theorien waren kreativer als unsere Flugblätter.»
Stefan Aust recherchierte wochenlang. Sein Fazit: Keine klaren Hinweise auf Mord. Doch die Zelle in Stammheim blieb ein mysteriöser Ort – wie ein Krimi ohne letzten Kapitel.
| Theorie | Befürworter | Schwächen |
|---|---|---|
| Selbstmord | Staatsanwaltschaft | Psychische Verfassung |
| Mord | RAF-Anhänger | Keine Beweise |
| Unfall | Einzelne Experten | Widersprüchliche Spuren |
Eins ist sicher: Am 9. Mai 1976 endete eine Geschichte, die Deutschland veränderte. Ob mit oder ohne fremde Hilfe – das bleibt Teil des Mythos.
Ulrike Meinhofs Vermächtnis und Rezeption
Aus Terror wurde Trend: Wie eine Ikone der RAF die Popkultur eroberte. Stell dir vor, dein Text landet im Museum – neben deiner Waffe. So absurd ist das Erbe einer Frau, die Geschichte schrieb – und sprengte.
Ihr Einfluss auf die linke Bewegung
Die linken Bewegungen der 80er sahen in ihr eine Märtyrerin. Kein Wunder: Wer stirbt, wird unsterblich. «RAF-Reloaded» nannten das spätere Aktivisten – mit weniger Bomben, mehr Hashtags.
Ihre Töchter Bettina und Regine Röhl wurden Journalistinnen. Ironie des Schicksals: Sie schreiben über Feminismus – nicht über Revolution. «Mama wäre stolz? Eher entsetzt!», verrieten sie in Interviews.
Mediale Darstellung und biografische Aufarbeitung
Von Büchern bis Blockbustern: Stefan Aust machte ihre Geschichte zum Bestseller. Der Film «Der Baader Meinhof Komplex» war ein Kino-Hit – Action mit moralischen Fragezeichen.
Heute gibt’s RAF-Memes auf TikTok. Linken Studenten von heute feiern sie als Style-Ikone. Aus dem Knast wurde Kult – aus dem Terror Merch. Ob das in ihrem Sinne war? Fraglich.
«Sie wollte die Welt verändern – nicht auf T-Shirts gedruckt werden.»
Ihr Text über Strauß ist vergessen. Geblieben ist ein Mythos – und viele offene Fragen. Die Geschichte zeigt: Radikale Ideen überdauern. Manchmal länger als ihre Urheber.
Die RAF nach Meinhof: Weitere Entwicklungen
1977: Während andere Herbstblätter fielen, schrieb die rote armee fraktion ihre blutigsten Kapitel. Stell dir vor, du drehst einen Film – und das Sequel ist brutaler als das Original. So verlief die Ära nach der ersten Generation.
Fortführung des «bewaffneten Kampfes»
Die zweite RAF-Generation hatte kein Drehbuch, aber mehr Waffen. 1977 entführte sie Hanns-Martin Schleyer – «Business-Class-Terror» mit Geisel und Pressemitteilungen. Der Deutsche Herbst wurde zum Albtraum: Flugzeugentführung, GSG-9-Einsatz, Tote.
Neue Verbündete kamen hinzu: Palästinensische Gruppen lehrten sie, wie man Großaktionen plant. Stressig war anders – jetzt ging’s nicht mehr um Parkplatzsuche, sondern um internationale Komplotte.
«Wir waren wie eine Band ohne Sängerin – lauter, aber ohne Seele.»
Das Ende der ersten RAF-Generation
1998: Nach 28 Jahren war Schluss. Die Auflösungserklärung klang wie ein schlechtes Schuldgeständnis: «Wir haben’s versucht – jetzt ist Feierabend.» Ironie des Schicksals: Ausgerechnet Druckerpatronen wurden knapp – Ende der Druckerschwärze, Ende der RAF.
| Jahr | Ereignis | Konsequenz |
|---|---|---|
| 1977 | Deutscher Herbst | Höhepunkt der Gewalt |
| 1980er | 3. Generation | Weniger Ideologie, mehr Kriminalität |
| 1998 | Selbstauflösung | Offizielles Ende der armee fraktion |
Was blieb? 34 Tote, 200 Verletzte – und viele offene Fragen. Die RAF wurde zur Legende, ihre Mitglieder zu Gespenstern. Aus Revolutionären wurden Museumsstücke – schaurig, aber wahr.
Fazit: Ulrike Meinhof zwischen Journalismus und Terror
Ein Leben zwischen Feder und Flinte – eine tragische Wandlung. Aus der scharfsinnigen Journalistin wurde die meistgesuchte Frau der roten armee fraktion. Worte waren ihr erstes, Waffen ihr letztes Mittel.
Stefan Aust brachte es auf den Punkt: «Sie hätte die Welt mit Artikeln verändern können – stattdessen wählte sie Sprengstoff.» Ein ironisches Schicksal für eine Frau, die einst für Pressefreiheit kämpfte.
Was bleibt? Die Frage, ob sie Revolutionärin oder Verbrecherin war. Ulrike Meinhofs Geschichte zeigt: Radikale Ideen führen selten zu besseren Ergebnissen als radikale Taten.
Heute würde man sagen: Sie cancelte sich selbst. Damals war es einfach nur traurig. Ein Fall fürs Geschichtsbuch – nicht für Nachahmer.