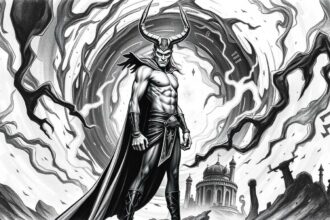Am 20. Dezember 2024 erschütterte ein Anschlag den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, darunter ein neunjähriger Junge. Über 300 Personen wurden verletzt. Der Täter, ein 32-jähriger Mann, sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Doch jetzt erreichen die Opfer verstörende Briefe aus dem Gefängnis. Mindestens fünf Betroffene erhielten Post mit wirren Tatbeschreibungen. Der Absender entschuldigt sich darin – doch die Worte wirken wie Hohn.
Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt: Juristisch lässt sich der Kontakt nicht unterbinden. Dies sorgt für politische Debatten. Opferverbände fordern strengere Schutzmaßnahmen.
Psychologen warnen vor den Folgen. Unerwünschte Kontakte können Traumata verstärken. Für die Angehörigen ist es ein weiterer Schlag.
Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt
Die Idylle des Magdeburger Weihnachtsmarktes wurde jäh durch einen brutalen Angriff zerstört. Am Abend des 20. Dezember 2024 raste ein dunkelblauer Pkw gezielt in die Menschenmenge. Der Fahrer soll mehrfach beschleunigt haben, bevor er gegen einen Holzladen prallte.
Die Tat am 20. Dezember 2024
Laut Augenzeugen geschah die Tat gegen 19:30 Uhr. Das Auto durchbrach fehlende Stahlketten – ein Sicherheitsmangel, der später kritisiert wurde. Der Täter, ein ehemaliger Stationsarzt, zeigte in der Blutprobe nur Beruhigungsmittel. Keine Spur von Alkohol oder Drogen.
Im Fahrzeug fand die Polizei ein handschriftliches Testament. Es trug das Datum des Angriffs. Experten werten dies als mögliches Indiz für eine geplante Tat.
Opfer und Verletzte
Die Bilanz des Abends war verheerend: Sechs Menschen starben, darunter eine 52-jährige Frau, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Über 300 Personen wurden verletzt, zwölf davon hatten ausländische Pässe.
| Opfergruppe | Anzahl |
|---|---|
| Todesopfer | 6 |
| Schwerverletzte | 89 |
| Leichtverletzte | 210 |
| Internationale Betroffene | 12 |
Erst im Januar 2025 starb ein weiteres Opfer an Spätfolgen. Die genaue Zahl der Geschädigten blieb unklar – viele meldeten sich erst Wochen später.
Briefe des Attentäters an die Opfer
Wochen nach dem Anschlag erreichen die Opfer verstörende Post. Fünf identische Briefe, verfasst vom Täter, wurden an Betroffene verschickt. Die Justizvollzugsanstalt Leipzig bestätigte den Absender – ein Akt, der juristisch nicht zu unterbinden ist.
Inhalt und Ton der Schreiben
Der Inhalt der Post wirkt wie eine Mischung aus Scheinreue und Provokation. Der Täter beschuldigt saudische Asylbewerber, ohne Beweise zu nennen. Die Schlusszeile «Mit freundlichen Grüßen, Taleb A.» verstärkt den zynischen Eindruck.
Psychologen deuten dies als Versuch, Macht auszuüben. Die Aufforderung, mit frankiertem Umschlag zu antworten, zeigt ein kalkuliertes Vorgehen.
Wie der Täter an die Adressen gelangte
Die Adressen der Opfer erhielt der Attentäter durch Akteneinsicht seines Verteidigers. Laut § 147 StPO ist dies legal, doch die Praxis wird nun kritisiert. Die JVA Leipzig überprüft ihr Postkontrollsystem.
Ein Opfer berichtet: «Der Brief lag plötzlich in meinen Ermittlungsakten.» Eine Sicherheitslücke, die politischen Handlungsbedarf offenlegt.
Reaktionen der Betroffenen

Ein ungeöffneter Brief im Briefkasten wurde für ein Opfer zum Albtraum. Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub fand sie das Schreiben – adressiert in handschriftlicher Schrift. «Das war ein Schritt zurück in der Verarbeitung«, sagt die 34-Jährige unter Tränen.
Schock und Wut unter den Opfern
Die betroffenen Familien beschreiben den Moment des Brieffunds als Schock. Eine Seelsorgerin bestätigt: «Unerwünschte Retraumatisierung ist hier das Hauptrisiko.» Besonders verstörend: Die Briefe kamen ohne Vorwarnung.
- Fallstudie: Ein Empfänger litt wochenlang unter Schlafstörungen.
- Statistik: 80 von 327 möglichen Opfern des Anschlags meldeten sich als Nebenkläger an.
Psychologische Auswirkungen
Therapeuten raten, unerwünschte Post ungeöffnet zu lassen. «Traumabewältigung braucht sichere Räume», erklärt eine Psychologin. Opferverbände bieten Krisenintervention an – doch die Angst vor weiteren Kontakten bleibt.
Langzeitfolgen zeigen sich auch bei Zeugen: Einige meiden Weihnachtsmärkte oder öffentliche Plätze. Die Briefe haben diese Ängste neu entfacht.
Rechtliche Perspektive und Ermittlungen

Juristische Experten untersuchen die Kommunikation des Täters aus der Haft. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg prüft, wie die Briefe an Opfer gelangen konnten. Kritiker fordern strengere Kontrollen in der Untersuchungshaft.
Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg
Klaus Tewes, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, verweist auf das Briefgeheimnis: «Postkontrolle ist nur bei konkretem Verdacht möglich.» Die Staatsanwaltschaft habe keine rechtliche Handhabe, wenn keine Drohungen vorlägen.
Ein historisches Urteil des BVerfG (1 BvR 479/92) stärkt diese Praxis. Doch Opferanwälte kritisieren Lücken: «Adressenfilter über Verteidiger sind ein Systemfehler.»
Möglichkeiten der Briefkontrolle in der Haft
Laut § 29 StVollzG darf Post in Haft nur unter strengen Bedingungen geprüft werden. Bundesländer handhaben dies unterschiedlich:
| Bundesland | Postkontrolle in U-Haft |
|---|---|
| Sachsen-Anhalt | Stichprobenartig |
| Bayern | Vollständige Prüfung |
| Berlin | Nur bei Verdacht |
Strafrechtler der Uni Halle fordern einheitliche Standards. «Opferschutz muss Vorrang haben», so Professorin Lena Hartmann.
Politische Debatte um Opferschutz
Der Fall des Magdeburg-Attentäters entfacht eine bundesweite Diskussion. Politiker und Verbände fordern strengere Regeln für den Umgang mit Opfern. Besonders der Zugang zu sensiblen Daten steht im Fokus.
Kritik von SPD-Politiker Rüdiger Erben
Rüdiger Erben, Justizexperte der SPD, wirft den Behörden Versagen vor: «Die Generalstaatsanwaltschaft hat ihre Schutzpflicht vernachlässigt.» Sein Vorwurf: Opferadressen dürften nicht an Täter weitergegeben werden.
Konkret kritisiert er § 406d StPO. Dieser erlaubt Verteidigern uneingeschränkten Aktenzugang. «Hier brauchen wir Filter – ähnlich wie in Österreich.»
Forderungen nach gesetzlichen Änderungen
Die Koalition streitet über eine Novelle des Strafprozessrechts. Geplant ist § 34a StPO:
- Adressenschutz: Opferdaten dürfen nur anonymisiert weitergegeben werden.
- Postkontrolle: Strengere Prüfung bei Kommunikation mit Geschädigten.
- EU-Vergleich: Niederlande blockieren solche Kontakte komplett.
Das Bundesjustizministerium verweist auf 327 Nebenkläger. Massenverfahren erfordern klare Regelungen – doch die Kosten sind hoch.
Fazit
Der Prozess um den Weihnachtsmarkt-Anschlags wird ab 2025 in einem neuen Sondergericht verhandelt. Das Gebäude entsteht derzeit in Magdeburg – die geplante Dauer: 18 bis 24 Monate.
Über 2,3 Millionen Euro Bundesmittel fließen in einen Opferfonds. Damit sollen Menschen unterstützt werden, die physische oder psychische Spätfolgen tragen.
Die Briefe des Täters zeigen: Kontakt zu Opfern bleibt ein sensibles Thema. Juristen und Politiker diskutieren schärfere Schutzmaßnahmen – ohne Freiheitsrechte einzuschränken.
Langfristig steht Magdeburg vor einer doppelten Herausforderung: Justizielle Aufarbeitung und Heilung des Stadtimages. Forschungsprojekte zur Prävention sollen ähnliche Taten verhindern.