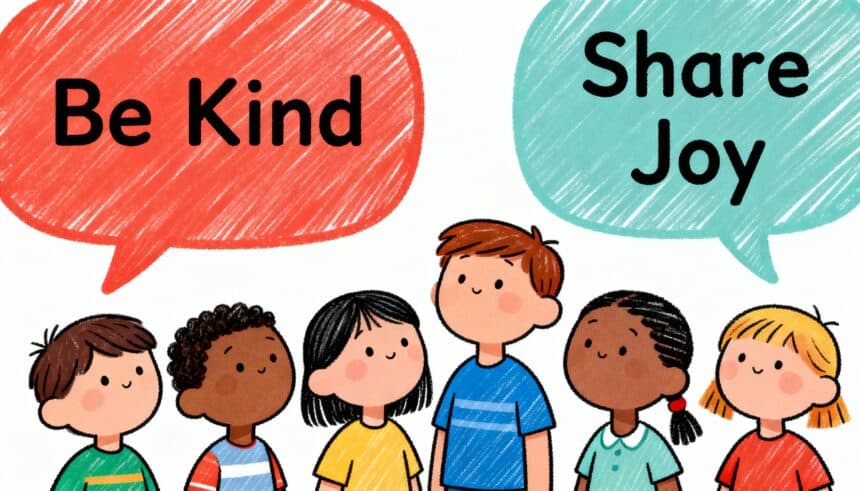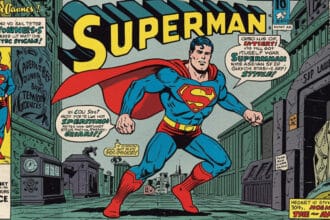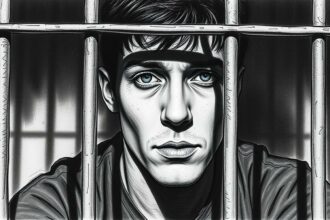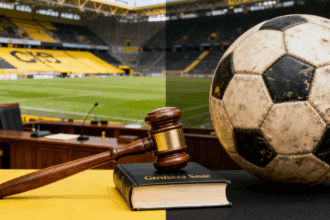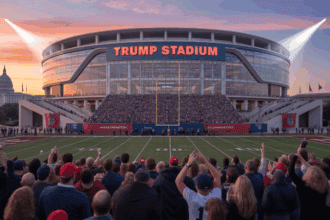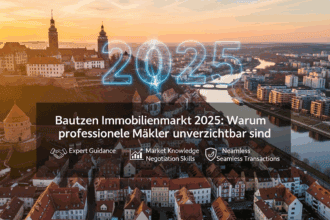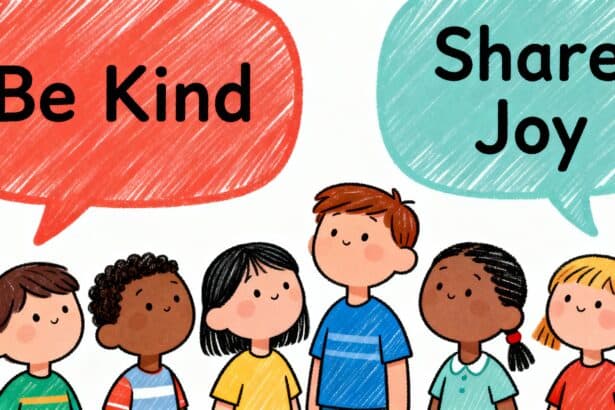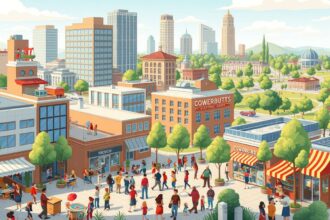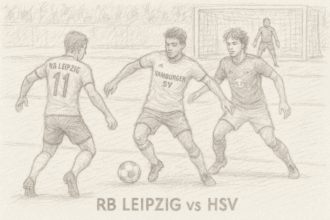Markenstimme mit Wirkung: So prägen Slogans das Image großer Unternehmen
Warum starke Worte noch immer zählen Egal ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht: Kaum etwas brennt sich so schnell in unser Gedächtnis ein wie ein clever formulierter Satz. Genau…
Markenstimme mit Wirkung: So prägen Slogans das Image großer Unternehmen
Warum starke Worte noch immer zählen Egal ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht: Kaum etwas brennt sich so schnell…
sowas von frisch
Berühmte Gräber
HOT HOT HOT
Wie funktioniert Bitcoin? Alles zur digitalen Währung
Bitcoin hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenidee zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Immer mehr Menschen interessieren sich…
Krypto Wallet erstellen. Wirklich tolle Anleitungen
Learn how to create a Krypto Wallet and invest in Altcoin with our expert beginner's guide. Uncover Altcoin investment potential.
Trading für Anfänger: Wie du erfolgreich startest
Starte erfolgreich ins Trading! Erhalte praktische Tipps und Anleitungen speziell für trading für anfänger.
Trading KI: Intelligente Entscheidungen treffen mit KI
Trading KI: Erfahren Sie, wie Sie KI-Tools für bessere Trading-Entscheidungen nutzen können. Ein Schritt-für-Schritt-Anleitung.